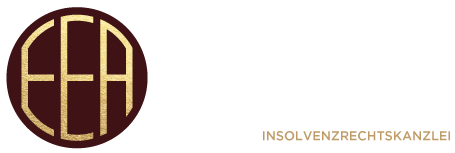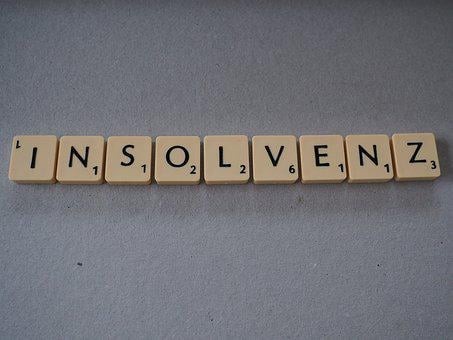Insolvenzrecht – Keine Haftung des Wirtschaftsprüfers der P&R-Gesellschaften
Insolvenzrecht – Keine Haftung des Wirtschaftsprüfers der P&R-Gesellschaften
Der Abschlussprüfer der deutschen P&R Vertriebsgesellschaften haftet Anlegern wegen der Erstellung der Jahresabschlussprüfung nicht auf Schadensersatz aus „Prospekt- oder Expertenhaftung“. (OLG München, Beschluss vom 21.04.2022 – 8 U 4257/21)
Hintergrund
Die Kläger hatten von deutschen Vertriebsgesellschaften, der so genannten P&R-Gruppe als Kapitalanlage Seefrachtcontainer gekauft. Im Gegenzug sollten feste Mietzinszahlungen erfolgen und es wurde ein bestimmter Rückkaufpreis in Aussicht gestellt. Der beklagte Wirtschaftsprüfer hatte für die Vertriebsgesellschaften jeweils Prüftestate über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts erteilt. In einer Informationsbroschüre für eine der Vertriebsgesellschaften fand sich ein Passus, wonach „unabhängige Wirtschaftsprüfer den Vertriebsgesellschaften die vollständige Vertragsabwicklung für die Containerinvestitionen testierten und die Vertriebsgesellschaft diese bewährte Abwicklung eins zu eins übernehme, so dass auch für dieses neue Konzept die gleiche gute Performance sichergestellt sei“. Über die Vermögen der Gesellschaften wurden keine drei Jahre nach dem Kauf die Insolvenzverfahren eröffnet. Hierbei haben Kläger und Anleger einen Großteil ihrer Investitionen verloren.
OLG München weist Berufung der Kläger zurück
Das OLG München hat die Berufung der Kläger, die erstinstanzlich vor dem Landgericht Landshut unterlegen waren, mit Beschluss zurückgewiesen. Das Gericht schloss in seiner Entscheidung zunächst spezialgesetzliche Prospekthaftungsansprüche aus § 306 KAGB mangels zeitlicher Anwendbarkeit der entscheidenden Regelung ebenso aus, wie eine Haftung nach richterrechtlicher Prospekthaftung im engeren Sinne. In § 306 KAGB ist die Prospekthaftung und Haftung für die wesentlichen Anlegerinformationen geregelt. Sind in dem Verkaufsprospekt Angaben, die für die Beurteilung der Anteile oder Aktien von wesentlicher Bedeutung sind unrichtig oder unvollständig, so kann der Käufer von der Verwaltungsgesellschaft, von denjenigen, die neben der Verwaltungsgesellschaft für den Verkaufsprospekt die Verantwortung übernommen haben, oder von denen der Erlass des Verkaufsprospekts ausgeht und von demjenigen, der diese Anteile oder Aktien im eigenen Namen gewerbsmäßig verkauft hat, als Gesamtschuldner die Übernahme der Anteile oder Aktien gegen Erstattung des von ihm gezahlten Betrages verlangen. Diese spezialgesetzlichen Prospekthaftungsansprüche sind im vorliegenden Fall nach Ansicht der Münchner Richter nicht gegeben. Letzteres bereits deshalb, weil es sich bei dem Containerkauf nicht um einen Beitritt zu einer Gesellschaft handele und es deshalb an einer gemeinsamen unternehmerischen Tätigkeit der Anleger fehle.
Auch Schadensersatzansprüche aus allgemeiner Prospekthaftung wurden verneint. Zwar sei die vom Wirtschaftsprüfer verwendete Informationsbroschüre als Prospekt im Sinne der Rechtsprechung des BGH zu werten. Eine allgemeine Vertrauenshaftung des Wirtschaftsprüfers scheitere jedoch daran, dass dieser selbst keine über das normale Verhandlungsvertrauen hinausgehende persönliche Gewähr für die Seriosität und ordnungsgemäße Erfüllung des Vertrags zwischen den Anlegern und den Vertriebsgesellschaften übernommen habe. Ihn treffe daher keine eigene Aufklärungspflicht, da das Vertragskonstrukt und dessen Risiken selbst betreffen. Auch sei der Beklagte nicht als Vertreter der Vertriebsgesellschaften aufgetreten, habe also keinen unmittelbaren Kontakt zu den Anlegern gehabt und auch sonst wäre es nicht zu einer Beeinflussung der Vertragsverhandlungen aufgrund eines von dem Beklagten in Anspruch genommenen persönlichen Vertrauens gekommen.
Das Gericht beleuchtete auch eine allgemeine sog. Expertenhaftung, die letztlich verneint wurde. Ein Experte hafte vertragsfremden Dritten nach den Grundsätzen des Vertrags mit Schutzwirkung zu Gunsten Dritter nämlich nur bei Inanspruchnahme eines konkreten Vertrauens, woran es hier fehlen würde. Die zitierte Passage in der Informationsbroschüre genüge hierfür ersichtlich nicht. So war der Beklagte nicht einmal namentlich genannt und hatte zudem lediglich die Jahresabschlüsse testiert, nicht aber den Prospekt selbst. Der Beklagte hatte daher auch ein Prospektprüfungsgutachten erstattet. Auch lagen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass die vorgenommene Prüfung auch im Interesse bestimmter Dritter durchgeführt werden sollte.
Da mögliche deliktische Ansprüche nach Ansicht des OLG München jedenfalls an der so genannten haftungsbegründenden Kausalität und an prozessualen Gegebenheiten scheiterten, wiesen die Münchner Richter die Berufung der Kläger im Ergebnis zurück.
Da die Revision zum BGH zugelassen wurde, bleibt es den Karlsruher Richtern vorbehaltenn, den gegenständlichen Fall neu zu entscheiden. Hierin liegt auch eine Chance, dass Anleger und damit Geschädigte in dem Insolvenzverfahren über die P&R Container den Wirtschaftsprüfer der deutschen P&R-Gesellschaften auf Schadensersatz in Anspruch nehmen könnten. So scheint die Meinung des OLG München in Bezug auf das Nichtvorliegen einer etwaigen Prospekt- oder Expertenhaftung zumindest nicht in Stein gemeißelt. Auch halten wir die Ausführungen der Münchner Richter zur fehlenden haftungsbegründeten Kausalität für nicht ausreichend. Insbesondere werden diese nicht den Maßstäben des BGH gerecht.
Geschädigte Anleger sollten daher prüfen, ob sie nicht rein vorsorglich den Wirtschaftsprüfer der deutschen P&R-Gesellschaften auf Schadensersatz in Anspruch nehmen, insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Angelegenheit noch vor dem höchsten deutschen Zivilgericht entschieden wird (BGH, kein Datum verfügbar, VII ZR 97/22).
Unsere auf das Insolvenzrecht spezialisierten Anwälte beraten Sie zur Möglichkeit der Geltendmachung von etwaigen Schadensersatzansprüchen gegen den Abschlussprüfer der deutschen P&R-Gesellschaften umfassend und kompetent.
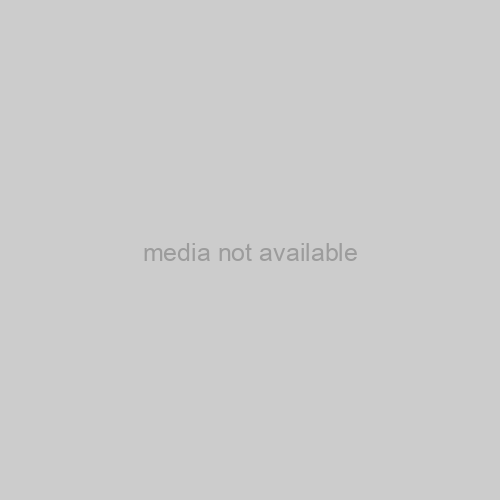
Rechtsanwalt Manuel Ast
Insolvenzanfechtungsrecht - Neuigkeiten im Insolvenzverfahren der P & R Container
Insolvenzanfechtungsrecht – Neuigkeiten im Insolvenzverfahren der P & R Container
Zum 31.12.2021 erhielten zahlreiche Anleger der P & R Container Vertriebs und Verwaltungs- GmbH Mahnbescheide vom Insolvenzverwalter der P & R sofern sie vorab keine Hemmungsvereinbarung unterschrieben hatten. Dies hat den Hintergrund, dass die Insolvenzverwalter gegenüber den Anlegern Insolvenzanfechtungsansprüche aus Schenkungsanfechtung gemäß § 134 InsO durchsetzen möchten und zum 31.12.2021 Verjährung eingetreten wäre. Die Insolvenzverwalter sind daher im Vorfeld auf die Anlieger zugegangen und haben darum gebeten, dass diese eine Verjährungshemmungsvereinbarung unterzeichnen. Dies um eine Hemmung der Verjährung der Ansprüche so lange zu erreichen, bis die Pilotverfahren abgeschlossen und die Angelegenheit höchstrichterlich entschieden wurde. Gegen die Mahnbescheide wurden dann in aller Regel Widersprüche eingelegt. Anstatt einer Anspruchsbegründung haben die Insolvenzverwalter nun zu den erstinstanzlichen Gerichten, an die das Verfahren vom zentralen Amtsgericht Coburg als Mahngericht abgegeben wurde, erneute Verjährungshemmungsvereinbarungen übermittelt, damit die Anleger diese unterzeichnen. Angeblich hätte man die entsprechende Anspruchsbegründung bereits im Entwurf vorliegen. Um den Anlegern aber entgegenzukommen, würde man nochmal die Möglichkeit eröffnen, eine Verjährungshemmungsvereinbarung abzuschließen, um den Ausgang der Pilotverfahren abzuwarten.
In unserer Kanzlei haben wir unseren Mandanten ausdrücklich davon abgeraten, eine Verjährungshemmungsvereinbarung zu unterzeichnen. Dies würde den Insolvenzverwaltern nur in die Karten spielen. So sind die Insolvenzverwalter nun gezwungen, ihren Anspruch zu begründen und erstinstanzliche Verfahren durchzustreiten. Die Insolvenzverwalter begründen ihren Insolvenzanfechtungsanspruch insbesondere mit § 134 InsO und tragen vor, dass sämtliche Zahlungen der Schuldnerin an die Anleger als unentgeltliche Leistungen gemäß § 134 InsO anfechtbar wären. Dem kann nicht gefolgt werden. Die Voraussetzungen der Schenkungsanfechtung sind nicht gegeben. Nach dem Inhalt des zwischen den Insolvenzverwaltern und den Anlegern geschlossenen Kauf- und Verwaltungsvertrag kann weder im Hinblick auf den von dem Anleger erhaltenen Rückkaufpreis noch auf die Tagesmietzinsen eine unentgeltliche Leistung angenommen werden (vgl. OLG München, Beschluss vom 20.05.2021 – 5 U 747/20; OLG Karlsruhe, Hinweisbeschluss vom 20.10.2021 – 3 U 18/20; OLG Hamm, Urteil vom 15.06.2021 – I-27 U; LG Karlsruhe, Urteil vom 10.07.2020, 20 O 42/20; LG Bochum, Urteil vom 04.09.2020, I-2 O 724/20; Landgericht Stuttgart, Urteil vom 08.10.2020 – 27 O 34/20; Landgericht Saarbrücken, Urteil vom 24.06.2021 – 4 O 52/20). Weiter sind auch die Voraussetzungen der übrigen Insolvenzanfechtungstatbestände nicht gegeben, weshalb der geltend gemachte Insolvenzanfechtungsanspruch der Insolvenzverwalter nicht durchsetzbar ist.
Wir raten daher davon ab, etwaige Verjährungshemmungsvereinbarungen zu unterzeichnen.
Unsere auf das Insolvenzrecht spezialisierte Kanzlei steht Ihnen bei der Abwehr von Insolvenzanfechtungsansprüche im Zusammenhang mit dem Insolvenzverfahren über das Vermögen der P & R Container Verwaltungs- GmbH kompetent zur Verfügung.
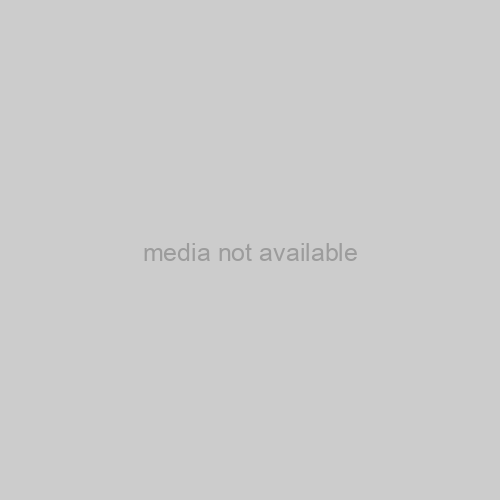
Rechtsanwalt Manuel Ast
Insolvenzanfechtungsrecht - BGH zur Rückgewährklage eines Insolvenzverwalters nach Insolvenzanfechtung: Zahlungsunfähigkeit als Indiz für den Benachteiligungsvorsatz
Insolvenzanfechtungsrecht – BGH zur Rückgewährklage eines Insolvenzverwalters nach Insolvenzanfechtung: Zahlungsunfähigkeit als Indiz für den Benachteiligungsvorsatz
Das Urteil des BGH vom 24.02.2022 – IX ZR 250/20 enthält neuerliche Ausführungen zu den Anforderungen an den Benachteiligungsvorsatz des Schuldners im Rahmen des § 133 Abs. 1 InsO sowie zu den Tatbestandsmerkmalen der Anfechtung nach den §§ 134, 135 InsO.
Der Leitsatz zu § 133 Abs. 1 S. 1 InsO lautet wie folgt:
Die Zahlungsunfähigkeit stellt nur dann ein Indiz für den Benachteiligungsvorsatz dar, wenn der Schuldner seine Zahlungsunfähigkeit erkannt hat. Hält der Schuldner eine Forderung, welche die Zahlungsunfähigkeit begründet, aus Rechtsgründen für nicht durchsetzbar oder nicht fällig, steht dies einer Kenntnis entgegen, sofern bei einer Gesamtwürdigung der Schluss auf die Zahlungsunfähigkeit nicht zwingend nahelegt.
Hintergrund
Der Kläger ist Insolvenzverwalter in dem Insolvenzverfahren über das Vermögen der K-GmbH. Das Stammkapital der Schuldnerin betrug € 25.000,00. Die Beklagte war Gesellschafterin der Schuldnerin und ursprünglich in Höhe von € 24.250,00 am Stammkapital der Schuldnerin beteiligt.
Am 23. Juli 2015 schlossen die Beklagte und die Schuldnerin als Lizenznehmerin einen Lizenzvertrag, wonach die Beklagte für bestimmte Patente, Marken und Know-How eine ausschließliche Lizenz erteilte. Die Schuldnerin versprach eine jährliche Lizenzgebühr in Höhe von € 180.000,00, von der zunächst € 15.000,00 zur Auszahlung kommen sollten. Zudem bestimmte der Vertrag, das in 2015 die anteilige Lizenzgebühr in Höhe von € 15.000,00 spätestens zum 31.12.2015 fällig wird. Am selben Tag schlossen die Schuldnerin und die Beklagte eine gesonderte Rangrücktrittsvereinbarung. Diese bestimmte, dass von der Forderung aus dem Lizenzvertrag € 15.000,00 von der Schuldnerin bezahlt werden und über die verbleibenden € 165.000,00 die Beklagte mit allen gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüchen aus und im Rang hinter sämtliche Ansprüche aller gegenwärtigen und zukünftigen Gläubiger der Schuldnerin zurücktritt. Am 22. Februar 2016 überwies die Schuldnerin € 15.000,00 unter Bezugnahme auf den Lizenzvertrag an die Beklagte.
Am 10. Juni 2016 stellte die Schuldnerin einen Insolvenzantrag. Das Insolvenzgericht eröffnete das Insolvenzverfahren mit Beschluss vom 21. September 2016 und bestellte den Kläger zum Insolvenzverwalter. Der Kläger verlangt die Rückzahlung der am 22. Februar 2016 gezahlten € 15.000,00. Das Landgericht hat die Beklagte antragsgemäß verurteilt. Auf die Berufung der Beklagten hat das OLG die Klage hinsichtlich des Anfechtungsanspruchs abgewiesen. Mit seiner zugelassenen Revision strebt der Kläger die Wiederherstellung des erstinstanzlichen Urteils an. Diese Revision hat Erfolg.
BGH: Schuldner muss seine Zahlungsunfähigkeit erkennen
In den Entscheidungsgründen wiederholt der BGH zunächst seine Ausführungen, wonach die subjektiven Tatbestandsmerkmale der Vorsatzanfechtung, da es sich um innere, den Beweis nur uneingeschränkt zugängliche Tatsachen handelt, meist nur mittelbar aus objektiven Tatsachen hergeleitet werden können. Soweit dabei Rechtsbegriffe wie die Zahlungsunfähigkeit betroffen sind, muss deren Kenntnis außerdem oft aus der Kenntnis von Anknüpfungstatsachen erschlossen werden. Diese Anknüpfungstatsachen sind sodann vom Tatrichter zu würdigen. Der Benachteiligungsvorsatz kann nicht allein darauf gestützt werden, dass der Schuldner im Zeitpunkt der angefochtenen Rechtshandlung erkanntermaßen zahlungsunfähig war. Hinzukommen muss dann, dass der Schuldner weiß oder in Kauf nimmt, auch künftig seine Gläubiger nicht befriedigen zu können.
Allerdings stellt die Zahlungsunfähigkeit nur dann ein Indiz für den Gläubigerbenachteiligungsvorsatz dar, wenn der Schuldner seine Zahlungsunfähigkeit erkannt hat. Ob der Schuldner seine Zahlungsunfähigkeit erkannt hat, hängt in erster Linie davon ab, ob er die Tatsachen kennt, welche die Zahlungsunfähigkeit begründen, und ob die gesamten Umstände zwingend auf eine eingetretene Zahlungsunfähigkeit hinweisen. Hierzu muss der Schuldner nicht nur die Forderung kennen, sondern auch deren Fälligkeit. Hält der Schuldner eine Forderung, welche die Zahlungsunfähigkeit begründet, aus Rechtsgründen für nicht durchsetzbar oder nicht fällig, steht dies einer Kenntnis entgegen, sofern bei einer Gesamtwürdigung der Schluss auf die Zahlungsunfähigkeit nicht zwingend naheliegt. Der Schluss auf die Zahlungsunfähigkeit liegt zwingend nahe, wenn sich ein redlich denkender, der vom Gedanken auf den eigenen Vorteil nicht beeinflusst ist, angesichts der ihm bekannten Tatsachen der Einsicht nicht verschließen kann, der Schuldner sei zahlungsunfähig.
Vorliegend ging die Schuldnerin im Zeitpunkt der angefochtenen Zahlung nicht davon aus, zahlungsunfähig zu sein. Aufgrund der schwierigen und streitigen Rechtsfragen durfte die Schuldnerin auch davon ausgehen, dass die gegen sie gerichteten Forderungen nicht fällig waren. Die Schuldnerin hatte damals ihre Zahlungsunfähigkeit jedenfalls nicht erkannt, der Schluss auf das Vorliegen der Zahlungsunfähigkeit war im entscheidenden Fall nicht zwingend. Da vom Kläger keine weiteren Indizien vorgelegt wurden, die einen Gläubigerbenachteiligungsvorsatz gestützt hätten, wurde § 133 Abs. 1 InsO vom BGH verlangt.
Fazit
Bereits mit dem Urteil vom 06.05.2021 – IX ZR 72/20 – hat der neunte Zivilsenat des BGH seine Rechtsprechungsänderung zur Vorsatzanfechtung nach § 133 InsO eingeleitet. Kernaussage dieser Entscheidung war, dass für das Vorliegen des Tatbestandsmerkmals des Gläubigerbenachteiligungsvorsatzes die Kenntnis des Schuldners erforderlich ist, auch künftig seine Gläubiger nicht vollständig bezahlen zu können. Diese Rechtsprechungsänderung wurde mit dem bereits von uns vorgestellten Urteil vom 10.02.2022 – IX ZR 148/19 – konkretisiert. Danach fehlt einem Anfechtungsgegner, der nur das Zahlungsverhalten des Schuldners ihm gegenüber kennt, in der Regel der für die Beurteilung einer drohenden Zahlungsunfähigkeit erforderliche Überblick über die wirtschaftlichen Verhältnisse des Schuldners. Weitere Konkretisierungen insbesondere zu den Anforderungen an den Gläubigerbenachteiligungsvorsatz des Schuldners enthalten die ebenfalls von uns vorgestellten Urteile vom 24.02.2022 – IX ZR 2050/20 sowie vom 03.03.2022 – IX ZR 53/19.
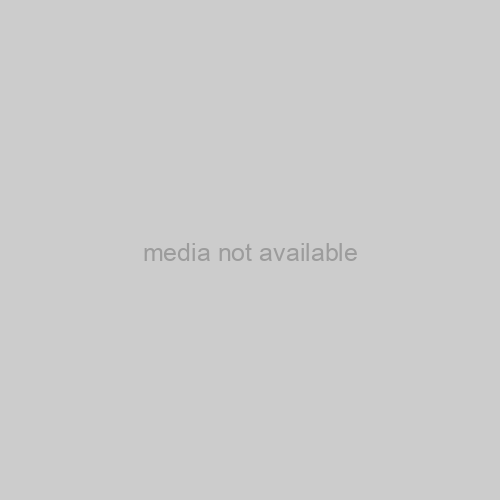
Rechtsanwältin Alexandra Lades
Insolvenzanfechtungsrecht - BGH zur Relevanz der insolvenzrechtlichen Überschuldung im Rahmen der Vorsatzanfechtung
Insolvenzanfechtungsrecht – BGH zur Relevanz der insolvenzrechtlichen Überschuldung im Rahmen der Vorsatzanfechtung
Der BGH hat in mehreren Entscheidungen die Voraussetzungen der Vorsatzanfechtung im Sinne des § 133 InsO konkretisiert und die Anforderungen an den Insolvenzverwalter für den Nachweis der subjektiven Merkmale erhöht, wie wir bereits in den vorangegangenen Blogs berichtet haben. Diese Linie führt der BGH nun auch in seiner Entscheidung vom 03.03.2022 – IX ZR 53/19 – fort.
Hintergrund
In dem Fall ging es um die Frage, welche Bedeutung der insolvenzrechtlichen Überschuldung für den Gläubigerbenachteiligungsvorsatz des Schuldners und die Kenntnis des Anfechtungsgegners von diesem Vorsatz zukommt. Die Karlsruher Richter stellten zunächst klar, dass die insolvenzrechtliche Überschuldung insoweit ein eigenständiges Beweisanzeichen darstellt. Seine Stärke hängt davon ab, mit welcher Wahrscheinlichkeit die Überschuldung den Eintritt der Zahlungsunfähigkeit des Schuldners erwarten lässt und wann der Eintritt bevorsteht. Insolvenzrechtlich überschuldet ist ein Rechtsträger, der nicht über ausreichend Vermögen verfügt, um seine bestehenden Verbindlichkeiten zu decken. Hinzutreten muss, dass die Fortführung des Unternehmens bis zum Ende eines zwölfmonatigen Prognosezeitraums nicht überwiegend wahrscheinlich ist. Eine negative Fortführungsprognose ist nach dem späteren Eintritt der Zahlungsunfähigkeit wahrscheinlich. Die Zahlungsunfähigkeit kann unmittelbar bevorstehen, sie kann aber auch erst am Rande des Prognosezeitraums eintreten. Es bedarf daher zusätzlicher, in der Art und Weise der Rechtshandlung liegender Umstände, um den Gläubigerbenachteiligungsvorsatz des Schuldners zu begründen. Mit Blick auf die Kenntnis des Anfechtungsgegners würde es nicht genügen, dass der Gläubiger, hier das Finanzamt, weiß, dass der Schuldner bilanziell überschuldet ist. Für die Annahme einer Überschuldung fehlt es nämlich an einer gesetzlichen Vermutung, weshalb der nach § 133 Abs. 1 InsO anfechtende Insolvenzverwalter den Eintritt der insolvenzrechtlichen Überschuldung voll beweisen muss.
Vortrag zur negativen Fortführungsprognose erforderlich
Dies gilt auch für die negative Fortführungsprognose. Kumulativ ist erforderlich, dass die insolvenzrechtliche Überschuldung dem Anfechtungsgegner bekannt geworden ist. Auf diesem zum Grundsatz soll der Insolvenzverwalter darlegen und beweisen. Der Nachweis der insolvenzrechtlichen Überschuldung wird im Anfechtungsprozess grundsätzlich nicht durch eine Handelsbilanz erleichtert, die einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag ausweist. Im Anfechtungsprozess ist daher nicht ausreichend, dass der Verwalter nur eine rechnerische Überschuldung darlegt, da daneben eine negative Fortführungsprognose und die Kenntnis des Anfechtungsgegners von dieser erforderlich sind. Vom außenstehenden Gläubiger kann nämlich nicht erwartet werden, dass er Umstände darlegt, dies aus damaliger Sicht rechtfertigten, das schuldnerische Unternehmen fortzuführen. Vielmehr ist grundsätzlich der Verwalter gehalten, zur negativen Fortführungsprognose vorzutragen. Dies gilt gleichermaßen für den Nachweis der Kenntnis des Anfechtungsgegners von der Überschuldung, selbst wenn diesem eine solche Handelsbilanz bekannt geworden ist.
Fazit
Der BGH hat die Voraussetzungen der Vorsatzanfechtung nach § 133 InsO also auch mit dieser Entscheidung erheblich verschärft. Der Beobachtungs- und Erkundigungsobliegenheit, die Verwalter in der Praxis oft sehen bzw. unterstellen, hat er eine gründliche Absage erteilt. Eine rechtliche Prüfung insolvenzanfechtungsrechtlicher Rückforderungsansprüche dürfte die Verteidigungschancen künftig weiter erhöhen.
Unsere auf das Insolvenzrecht spezialisierten Anwälte stehen Ihnen in Bezug auf das Insolvenzanfechtungsrecht kompetent zur Verfügung.
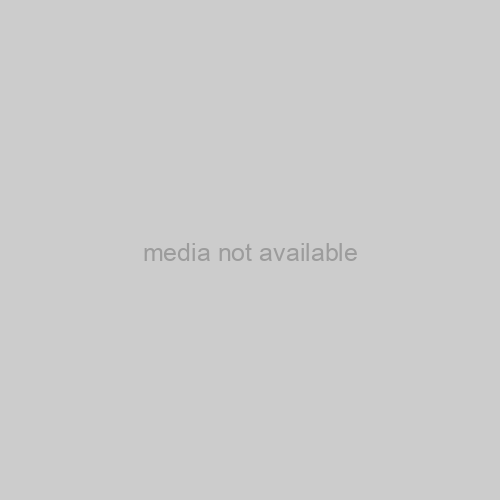
Rechtsanwältin Alexandra Lades